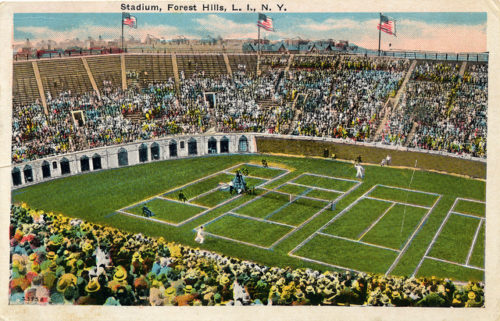Es ist halb zehn Uhr Abends. Im Hinterhofclub La Loge im 11e Arrondissement steht gleich die französische Hipsterentdeckung Pi Ja Ma auf der Bühne. Ich stehe am Rand des Saals und schaue mir das Publikum an. Sie sehen nicht viel anders aus als in Berlin oder in London. Viele haben ein Bier in der Hand, tragen Stan Smith und vornehmlich schwarze Kleidung. Doch irgendwas ist dennoch anders. Irgendwas.

Da es bestimmt noch 20 Minuten geht, bis Pi Ja Ma ihren grossen Auftritt hat, nehme ich mal mein iPhone aus der Tasche. Es kann ja sein, dass ich eine total wichtige Nachricht verpasst habe. Nicht auszudenken, wenn ich die nicht gleich sehe…
Genau in diesem Moment geht mir ein Licht auf. Ich weiss jetzt, was hier anders ist, als überall anders. Ausser mir spielt hier niemand mit seinem Handy. Kein Einziger hat das Verlangen, mit der Aussenwelt verbunden zu sein. Kein Einziger starrt in seinen Screen und kein Einziger tippt wie wild, um allen via Instagram, Snapchat, Facebook oder Twitter zu zeigen, wie toll sein Leben ist.
Mann ist das erfrischend. Das Ganze strahlt so eine uhnheimliche Ruhe aus. Ich checke kurz, ob das alles nur daran liegt, dass hier im Saal kein guter Empfang ist. Doch nein, der Empfang ist klasse. Das Publikum verzichtet also ganz freiwillig auf das Smartphone. Dass ich das noch erleben darf… Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben.
Jetzt ist es endlich so weit. Pi Ja Ma steht auf der Bühne. Sie legt los und ist klasse. Sie singt, malt und bezirzt. Das Publikum ist begeistert und dennoch halten nicht alle wie blöd ihr Phone in die Höhe und nehmen eine Show auf, die sie bestimmt nie mehr wieder anschauen werden. Bien fait, Paris. Je vous adore.
Falls ihr Euch fragt, wer diese Pi Ja Ma eigentlich ist. Voilà: